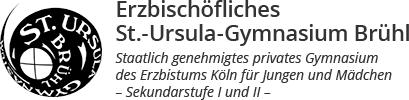Die Verbindung zwischen dem St.-Ursula-Gymnasium Brühl und der ANDHERI HILFE Bonn besteht schon seit über 55 Jahren. Es ist inzwischen das 11. Projekt, das die Schülerinnen und Schüler vor einem Jahr als ihr »Herzensprojekt« ausgewählt haben und alle zwei Jahre mit einem großen Basar und auch zwischendurch durch verschiedene andere Aktionen (z. B. Spendenlauf, Tombola etc.) unterstützen. Beim aktuellen Projekt »Hoffnung für jedes Kind – gegen Diskriminierung und Kinderarbeit« geht es um Hilfe zur Selbsthilfe für die Musahar, die Ärmsten der Armen in Nordindien.
Die ersten Fotos und Projektberichte, die den Schülerinnen und Schüler von den Projektkoordinatoren der ANDHERI HILFE geschickt werden, gehen unter die Haut. Das Elend dort muss unermesslich und kaum vorstellbar sein: nur mit ein paar Lumpen bekleidete, ausgehungerte Kinder auf Müllhaufen oder in Hütten mit Dächern aus Plastikfetzen.
Vor diesem Hintergrund löste im Frühsommer 2024 die Einladung der ANDHERI HILFE zu einer »Multiplikatorenreise« nach Indien bei den angesprochenen Lehrkräften Begeisterung aus, rief aber auch Respekt hervor. Aber die Aussicht, ein Projekt der Musahar besuchen zu können, ließ letzte Zweifel schwinden und war der Beginn eines gemeinsamen Abenteuers, das alle Mitreisenden tief berührte, aber auch die Menschen vor Ort.
Die Musahar sind in Indien die Ärmsten der Armen. »Musahar« bedeutet übersetzt »Rattenesser«, auch wenn sie sich heutzutage überwiegend von Reis, Fisch und Ernteresten ernähren. Sie sind zumeist landlos und arbeiten häufig als »bonded labour« auf den Feldern höherkastiger Bauern oder auch als Wanderarbeiter, z. B. in Ziegelfabriken. Die Alphabetisierungsrate liegt bei nur 3–5 Prozent.
Die Musahar sind »Mahadalits«, d. h. unter der tiefsten Kaste (»Dalits«) im Kastensystem der hinduistischen Gesellschaft verortet und werden als »Unberührbare« bezeichnet. Deshalb werden sie in allen Lebensbereichen auf das Schärfste diskriminiert: Sie gelten als so unrein, dass sie kein Wasser am Dorfbrunnen schöpfen dürfen. Wenn sie auf den Feldern arbeiten, wird unterstellt, dass allein durch die Berührung ihrer Hände die Ernte verdorben werde. Ihre schulpflichtigen Kinder werden in der Schule beschimpft und bespuckt, wenn sie überhaupt zur Schule gehen dürfen. Dies hat zur Folge, dass die Wenigsten lesen und schreiben können. Hinzu kommt, dass die Kinder häufig Hausarbeit verrichten, Tiere hüten und auf den Feldern mitarbeiten müssen.
Zum Überleben bleibt den Musahar meist nur das Sammeln und Verkaufen von Müll, doch das reicht nicht für das Nötigste. Circa 85 Prozent von ihnen, vor allem die Kinder, sind unterernährt. Die Lebenserwartung liegt bei nur 45–50 Jahren.
Das Vorwissen über diese Zustände und Gegebenheiten lässt eine Begegnung auf den ersten Blick schwierig erscheinen – aber gerade darin wurden wir eines Besseren belehrt.
Schon der Empfang in den Dörfern verwunderte uns: Wir tauchen ein in ein Meer von bunt gekleideten Menschen, die uns mit Trommelklängen und Blumenketten begrüßen. Wir wissen nicht, wie uns geschieht und sind ergriffen von dieser Zeremonie. Ein Lächeln unsererseits wird mit so vielen freundlichen, zunächst sehr scheuen, dann aber glücklichen Blicken erwidert. Die erst zurückhaltenden Frauen, die abwartend beobachten, ob wir uns von ihnen berühren lassen (mitsamt der Dorfgemeinschaft im Rücken), atmen sichtlich auf, als wir uns von ihnen mit roter Pulverfarbe den Segenspunkt auf die Stirn malen lassen. Große Erleichterung geht durch die gesamte Dorfgemeinschaft.
Die Türen der einfachen Häuser werden uns zögerlich geöffnet. Ungläubiges Staunen vieler Menschen, dass sich überhaupt jemand für sie und ihre Lebensumstände interessieren könnte, wird bemerkbar. Rosan, der indische Projektkoordinator, den die Dorfbewohner kennen, erklärt, warum wir gekommen sind; so wächst Vertrauen.
Im Dorf gibt es keine Toiletten; überall rinnen übelriechende Abwasser über die schmalen Pfade; es gibt nur einen einzigen Brunnen, aus dem Wasser geschöpft, in dem aber auch gewaschen wird. Nicht alle Bewohner des Dorfes haben ein festes Dach über dem Kopf, viele leben im Freien, geschützt nur durch an Ästen befestigte Plastikplanen. Die Menschen besitzen nicht viel – ein paar Tücher, auf denen auf dem harten Boden gegessen und geschlafen wird, und Kochgeschirr aus Metall. Fliegen gibt es überall, das Weinen der Säuglinge und der trockene Husten einiger Dorfbewohner klingt in den Ohren.
Wir beenden unseren Rundgang und setzen uns auf den Boden im Bridgecenter. Die Frauen und einige Kinder leisten uns Gesellschaft, die Männer bleiben misstrauisch vor der Türe. Das »Bridgecenter« ist ein Versammlungsort und Bildungszentrum für die gesamte Dorfgemeinschaft. Vormittags findet hier die Vorschule statt, nachmittags treffen sich mal die jungen Frauen, mal die Mütter. Sie zeigen uns, welche Fortschritte sie durch das Projekt unserer Schule erzielen konnten: Die Kinder können das englische Alphabet und einfache Rechnungen. Außerdem bekommen sie eine warme Mahlzeit am Tag. Die jungen Frauen werden im Kunsthandwerk unterrichtet. Mit ihrer Lehrerin Anita Gupta stellen sie Schmuck und Wohnaccessoires wie handbestickte Decken und Türschmuck her, die ihnen regelmäßige Einkünfte sichern. In einem gerade eingeweihten Kosmetikstudio verdienen sie sich während der Hochzeitssaison mit Henna-Tattoos, Hand-, Fuß- und Haarpflege etwas dazu. Diese Tätigkeiten und die daraus resultierenden Einkünfte stärken das Selbstvertrauen und lässt sie erkennen, dass auch die Musahar Menschen mit Fähigkeiten sind und ein Recht auf ein Leben in Würde haben.
Auch die verheirateten Frauen, die sich in größeren Abständen treffen, müssen zunächst über den indischen Projektkoordinator Rosan Vertrauen fassen. Doch dann erzählen sie viel: Sie haben eine gemeinsame Sozialkasse geschaffen, legen Geld in einer Kiste für Notfälle beiseite, um sich gegenseitig zu helfen. Gemeinsam diskutieren und lernen sie, welche Gesundheitsvorsorge sie in Anspruch nehmen können und wie sie sich registrieren lassen können.
Wir haben Fragen an diese fremden, aber in dieser kurzen Zeit schon so liebgewonnenen Menschen, und sie haben Fragen an uns. Wir könnten noch stundenlang zusammensitzen. Sie begleiten uns zu unserem Kleinbus, wollen uns nur ungern ziehen lassen. Und auch uns fällt der Abschied schwer. All das berührt uns sehr: Wie die Menschen aufblühen, was in ihnen steckt, wie sie ihr Schicksal in die Hand nehmen, wie stark die Frauen sind, was sie alles schon erreicht haben und dass sie nicht aufgeben, sondern sich jeden Tag neue Ziele setzen.
Wir sind ergriffen, wie viel Hilfe zur Selbsthilfe bewirken kann, und sagen »Namaskar und Dhanyawaad!« Auf Wiedersehen. Wir sind in tiefer Dankbarkeit!
(Röd)
Fotos: Theophil Lappe / Röd